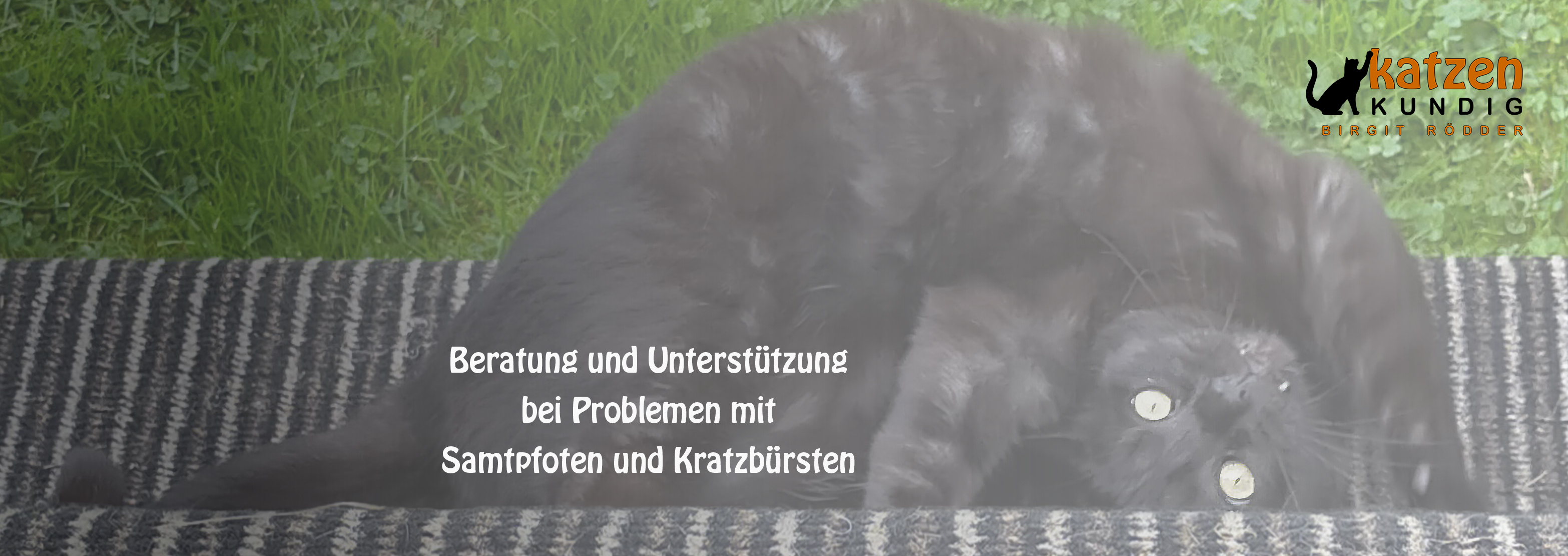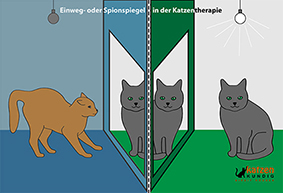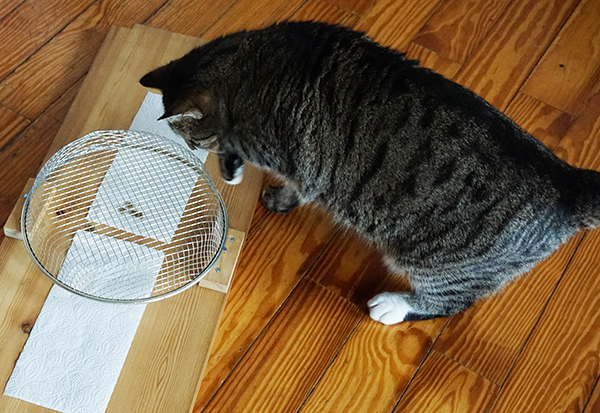Beziehungen

Katzen sind wie Menschen Individuen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, Vorlieben und Abneigungen. Es ist daher zu erwarten, dass auch jede Beziehung zwischen beiden einzigartig ist. Sie wird z.B. von Alter, Geschlecht und Persönlichkeit beider Partner beeinflusst sowie durch Lebensraum bzw. Haltungsbedingungen wie Fütterung, Auslauf Anzahl der Menschen, Katzen und weitere Tiere im Haushalt.
Außerdem bestehen tatsächlich zwei unterschiedliche Beziehungen: die der Katze zu ihrem Sozialpartner Mensch – die Katze-Mensch-Beziehung – und die des Menschen zu seiner Katze – die Mensch-Katze-Beziehung.
Katze–Mensch-Beziehungen
Die Beziehung der Katze zu Menschen wird von genetischen und erlernten Faktoren beeinflusst. Dadurch kann der Mensch für sie Feind, Nahrungslieferant oder Sozialpartner bedeuten, der kann wiederum Spielkamerad, Mutterersatz oder vertraute Bezugsperson sein.

Die Beziehungen zwischen beiden Parteien werden u.a. von Alter, Geschlecht und Persönlichkeit beider Partner beeinflusst sowie durch Lebensraum bzw. Haltungsbedingungen, wie Fütterung, Auslauf Anzahl der Menschen, Katzen und weiterer Tiere im Haushalt.
Bedeutung des Menschen
Genetische Veranlagungen tragen auch zur Ausbildung unterschiedlicher Verhaltensstile und Charaktereigenschaften von Katzen bei, den Persönlichkeitsmerkmalen. Besonders deutlich wird dies bei Rassekatzen. Auch die unterschiedliche Zutraulichkeit von Katzen gegenüber Menschen wird dadurch beeinflusst.
Die Bedeutung des Menschen entsteht jedoch hauptsächlich durch die Sozialisation, d.h. die Erfahrungen mit Menschen zwischen der zweiten und siebten Lebenswoche der Katzenwelpen. Abhängig von Veranlagung und Früherfahrungen verhalten sie sich auch als erwachsene Katzen gegenüber Menschen scheu oder freundlich. Die erlernten Erwartungen können sich auf einen bestimmten Menschentyp beschränken. Durch angenehme Kontakte mit verschiedenen Menschen, im Idealfall Männern, Frauen, Kindern, können sie aber auch verallgemeinert werden; solche Katzen verhalten sich auch den meisten fremden Menschen gegenüber zutraulich.
Die Früherfahrungen werden nicht von einer Tierart auf eine andere übertragen, die Sozialisation gegenüber Artgenossen und Menschen schließen sich aber auch nicht gegenseitig aus. Eine frühe Trennung der Katzenwelpen von ihren Artgenossen ist also nicht vorteilhaft für eine gute Bindung an den Menschen. Sie ist eher kontraproduktiv, weil nach der Sozialisation bis zur 12. Lebenswoche weitere soziale Erfahrungen mit Wurfgeschwistern, Mutter und gegebenenfalls anderen sozialen Katzen von großer Bedeutung für die Entwicklung ihrer Selbstbeherrschung sind. Die Abgabe von Kätzchen ist daher frühestens am Ende ihres dritten, besser noch des vierten Lebensmonats anzuraten.
Auch spätere Lernerfahrungen beeinflussen die Einstellung der Katzen zu Menschen und die Beziehung. Eine regelmäßige Fütterung erleichtert die Kontaktaufnahme und den Aufbau einer Beziehung. Für deren weitere Entwicklung sind jedoch andere Interaktionen wichtig. Insbesondere Routinen bzw. Rituale tragen zum Aufbau einer guten und stabilen Bindung bei, z.B. Füttern, Spielen, Streicheln und gemeinsames Ruhen. Vor allem sind es gleiche Abläufe zu weitgehend gleichen Tageszeiten an bestimmten Orten, die der Katze Sicherheit vermitteln.
Bedeutung der Umwelt
Für die psychische Entwicklung der Katze ist auch ihre unbelebte Umwelt von großer Bedeutung. Vielfältige Reize in ihrer frühen Jugend vergrößern ihre Toleranz gegenüber späteren Umweltveränderungen, die im Leben fast jeder Katze zwangsläufig auftreten. Dagegen führen unzureichende oder unpassende Haltungsbedingungen während der Jugendentwicklung häufig zu mangelnder Flexibilität des Verhaltens und/oder Fehlprägung.
Dies betrifft auch von Menschenhand aufgezogene oder zu früh abgegebene Kätzchen, die meist durch eine unzureichende Selbstkontrolle, übermäßige Anhänglichkeit oder Ängstlichkeit, oder offensive Aggression auffallen. Zu früh entwöhnte Welpen sind außerdem häufig krankheitsanfällig und leiden an Verhaltensstörungen, meistens Saugen an Gegenständen oder Körperteilen.
Große Erwartungen
Wenn die Früherfahrungen von Katzen stark von ihren späteren Lebensbedingungen abweichen, ergeben sich häufig folgende Problemkomplexe:
- Überforderung von isoliert oder abgelegen aufgewachsenen "Wildkatzen" in reiner Wohnungshaltung sowie unzureichend sozialisierter Katzen im Zusammenleben mit einer "lebensfrohen" Familie;
- Unterforderung von gut sozialisierten und umweltstabilen Katzen in reizarmer Umgebung, alleine oder mit schlecht sozialisierten, potenziellen Einzelkatzen und ohne ausreichende Beschäftigung.
Fehlende Ausgleichsmöglichkeiten wirken sich auch auf die Beziehung zum Menschen aus und dies in aller Regel negativ. Andererseits können scheue Katzen in einer ruhigen Umgebung, die ihrer frühen Jugend entspricht, eine enge Bindung an eine umsichtige Einzelperson eingehen. Und Katzen, die sich etwa unter beschränkten Haltungsbedingungen gegenüber ihren Haltern aggressiv verhalten, können sich unter geeigneten, für das Individuum passenden Umständen sogar zutraulich zeigen.
Mensch–Katze-Beziehungen
Die Fürsorge für Hauskatzen, ihre Beobachtung und Pflege, Beschäftigung und v.a. der Körperkontakt durch Streicheln einer Katze wirken z.B. blutdrucksenkend, dadurch beruhigend und insgesamt gesundheitsfördernd. Kinder profitieren vom Zusammenleben mit Katzen etwa durch eine Stärkung ihrer Abwehrkräfte und Förderung des Verantwortungsgefühls. Es wundert daher nicht, dass die Zahl der Katzen auch in deutschen Haushalten immer weiter zunimmt.

Probleme im Zusammenleben entstehen häufig durch falsche Erwartungen an die Katze, Missachtung ihrer biologischen und/oder psychischen Bedürfnisse und zu unbedarften Umgang.
Erwartungen an die Katze
Die Beziehungen von Menschen zu Katzen sind äußerst unterschiedlich und reichen von einer "Nutztierhaltung" im Sinne der Mäusejagd, etwa in landwirtschaftlichen Betrieben, bis zum Partner- oder Kindersatz. Viele Menschen wählen ihre neue Katze leider häufig anhand des Aussehens, statt der wichtigeren Persönlichkeitsmermale, die dabei teilweise völlig übergangen werden. Dies ist schon deshalb kritisch, weil die Beziehung nachhaltig leiden kann, wenn die Persönlichkeit der Katze stark von den erwarteten Eigenschaften abweicht.
Die Lebenserwartung von Hauskatzen liegt bei guter Pflege und tierärztlicher Betreuung nicht selten bei 20 Jahren. Deshalb sollten auch die Überlegungen zur Katzenhaltung möglichst langfristig stattfinden. Auch sollte man berücksichtigen, ob sich wohl die Lebensführung verändern wird, z.B. Ausbildung oder Familiengründung, um die Anpassungsfähigkeit einer neuen Katze nicht überzustrapazieren.
Bedürfnisse akzeptieren
Die Aufnahme einer Hauskatze bedeutet die Pflege eines kleinen, ursprünglich dämmerungs- und nachtaktiven, territorialen und solitär lebenden Raubtiers. Seine individuellen Bedürfnisse können durchaus unterschiedlich ausfallen, bei Missachtung jedoch zu zahlreichen Verhaltensauffälligkeiten und Konflikten führen. Sie müssen auch in reiner Wohnungshaltung weitgehend erfüllt werden, inklusive Berücksichtigung ihres Erkundungs- und Beutefangverhaltens. Dies bedeutet für den Halter täglich mehrere Stunden Beschäftigung seines Haustiers in einer katzengerecht eingerichteten Wohnung und einigen Einsatz zur Erfüllung der teilweise recht anspruchsvollen Bedürfnisse.
Gute Umgangsformen
Zu falschem Umgang gehören unüberlegte Interaktionen bei der Zusammenführung von Katzen. Ignorieren von heftigen Kämpfen und Verfolgungsjagden verschärfen die Situation genauso wie eine völlig fehlende oder falsche Erziehung der Jungkatze ohne Rücksicht auf deren Erfahrungen und spätere Erwartungen. Junge Katzen werden oft über die Maßen mit Aufmerksamkeit und anderen Zuwendungen bedacht und entwickeln dann eine enorme Anhänglichkeit. Ungünstige Umgangsformen, aber auch heftige Kampfspiele führen bei der erwachsenen Katze oft zu erhöhter Aggressivität, die man nicht mehr tolerieren mag. Und Strafen sind für die Katze nicht verständlich, enttäuschend und frustrierend.
Aus Unwissenheit und/oder Hilflosigkeit werden oft auch angstmotivierte Verhaltensweisen bestraft, Fauchen und Pfotenschläge, die in der Regel der Abwehr dienen. Sie können sogar mit Angriffselementen gepaart auftreten und dann einen Scheinangriff zur Verteidigung darstellen. Die Strafen bedeuten für die Katze jedoch eine – zusätzliche – Bedrohung und verstärken ihre Abwehr in der nächsten Konfliktsituation. Es ist daher sinnvoll, dass Katzenhalter zwischen defensiver und offensiver Aggression unterscheiden können oder eine/n KatzenpsychologIn zu Rate ziehen, da die Abgrenzung oft schwierig ist.
Generell haben Strafen oft nicht die gewünschte Wirkung, sondern lösen Furcht aus oder Abwehr. Daher sollte man besser erwünschte Verhaltensweisen verstärken bzw. belohnen. Beide, sowohl Bestrafung als auch Belohnung, erfordern eine sorgfältige Auswahl und exaktes Timing, um als solche wirken zu können. So werden durch zu späten Einsatz von Strafen oft erwünschte Verhaltensweisen getadelt oder die Beziehung zum Menschen belastet, und durch unpassende Belohnung unerwünschte Verhaltensweisen verstärkt.
Zu den guten Umgangsformen zählen
Blinzeln
Zwei bis vier Mal die Augenlider langsam schließen und wieder öffnen heißt auf Kätzisch "Ich bin freundlich und friedlich". Seien sie es auch; also bitte nicht blinzeln, bevor Sie der Katze die Wurmkur ins Mäulchen schieben wollen. Der Trick funktioniert natürlich nur bei Blickkontakt zwischen Katze und Mensch.
Freundliche Ansprache
Katzen können sich an vieles gewöhnen, auch an herzhaftes Lachen oder laut spielende Kinder. Spätestens in einer ruhigen Umgebung spricht man besser leise mit Katzen, sie können schließlich sehr gut hören – reagiert Ihr Senior oder die Seniorin nicht mehr auf Ihre Ansprache, werden Sie lauter. Ein freundlicher Ton spricht Bände – der Ton macht die Musik. Zur Begrüßung eignet sich am besten eine Frage; sie hört sich an wie das Begrüßungsgurren der Katzen.
Auf die Katze eingehen
Katzen sind Individualisten und ursprünglich Einzelgänger. Sie richten sich oft nach der Aktivität ihrer Menschen, aber die besten Beziehungen entstehen, wenn man auf die Bedürfnisse der Katze eingeht. Dann lernt die Katze, dass sie sich auf Sie verlassen kann. Es sollte allerdings Ausnahmen geben.
Wenn der Mensch immer springt, wenn die Katze ruft, gerät man in eine Abhängigkeit. Hat man einmal keine Zeit, löst eine Absage bei der Katze Frust und Enttäuschung aus.
Es gibt sehr viele Details, die das Zusammenleben mit Katze erleichtern und verschönern. Ich helfe Ihnen und Ihrer Samtpfote gerne weiter.
Katze–Katze-Beziehungen
Hauskatzen sind die einzigen Haustiere, die von Einzelgängern abstammen. Ihre Vorfahren, die Falbkatzen des Vorderen Orients, gehen ihren Artgenossen außerhalb der Fortpflanzungszeit gerne aus dem Weg. Während ihrer Domestikation wurden sie nicht nur zutraulicher zu Menschen und vermehrten sich, sondern lernten auch, mit ihresgleichen zurechtzukommen.

Potenzial zum Gruppenleben
Es sind v.a. kindliche Verhaltensweisen, die Hauskatzen bis ins hohe Alter behalten und die ein friedliches Zusammenleben möglich machen. Dadurch werden Konflikte in Grenzen gehalten, die ihre Gesundheit belasten – eine wichtige Errungenschaft, denn durch die immer größere Anzahl Katzen treffen sie auch häufiger aufeinander. Das führt auch dazu, dass Katzen, wenn sie ausreichend mit Futter versorgt werden, in Gruppen leben. Deshalb findet man Hauskatzen auch dort, wo sie selbst ihren Lebensraum wählen können, in größerer Anzahl, z.B. auf Bauernhöfen in Familienverbänden und in Städten in Kolonien.
Allerdings wurde die Katze erst vor ca. 4000 Jahren zum Haustier. ihr Sozialleben ist also noch sehr „jung“. Es wird sich sicher noch weiterentwickeln, darüber sind sich viele Katzenforscher einig. Und die soziale Kompetenz jeder Hauskatze hängt von verschiedenen Faktoren ab, Veranlagung und Erfahrungen v.a. in der Jugend. Dies erklärt, warum manche Katzen nicht ohne Artgenossen leben können, während andere absolute Einzelgänger sind.
Katzenbeziehungen sind individuell
Die Beziehungen zwischen Katzen sind sehr individuell, die Parteien sind nicht beliebig austauschbar. Genau genommen sind Katze–Katze-Beziehungen nicht nur einzigartig, sondern meist auch asymmetrisch. Das heißt, dass Minka andere Erwartungen an Paula hat als Paula an Minka. Das kennen wir auch von uns Menschen.
Die Qualität der Beziehungen hängt von diesen gegenseitigen Erwartungen ab, allerdings auch von den Persönlichkeitsmerkmalen aller Beteiligten. Vor allem in Aktivität und Selbstsicherheit gegenüber Artgenossen sollten sie sich ähnlich sein. Katzen unterscheiden sich in diesen Gesichtspunkten teilweise deutlich voneinander. Ihre Aktivitätslevel sind z.B. bei vielen Rassen sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängen natürlich auch vom Alter ab. Außerdem lieben Kater i.d.R. "deftige" Prügelspiele, während Kätzinnen sich lieber gegenseitig putzen und mit Bällchen und Kordel spielen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Deshalb ist es nicht ratsam, z.B. zur 16-jährigen Perserkätzin einen halbjährigen Bengalkater aufzunehmen. Seine Spielvorlieben werden sie völlig überfordern, während er keine geeigneten Sozialkontakte pflegen kann und sich langweilt – leider eine "gute" Basis für Verhaltensauffälligkeiten.
Einzelkatze, Paar oder Mehrkatzen?
Es ist heutzutage empfehlenswert, junge Katzen mindestens im Doppelpack aufzunehmen. Sie müssen keine Geschwister sein, vielmehr charakterlich zusammenpassen, damit sie ihr Leben lang gut miteinander auskommen. Dann bestehen auch gute Chancen, dass sie auch andere Katzen akzeptieren, mit denen sie später zusammenleben. Denn die meisten Hauskatzen sind gesellige Einzelgänger: Sie lieben ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, aber auch geselliges Beisammensein mit Artgenossen. Dabei suchen sich aber gerne aus, wann eine gute Zeit für den "Stammtisch" ist und wann nicht. In wissenschaftlichen Studien fand man heraus, dass sechs eine gute Obergrenze für einen Multikatzenhaushalt ist. Größere Gruppen teilen sich oft in diese 6er Einheiten auf und sind nur innerhalb dieser Kleingruppen weitgehend gesellig, gehen sich ansonsten aus dem Weg.
Je früher eine Katze von ihrer Familie getrennt wurde und je länger sie alleine – ohne Artgenossen – lebt, desto weniger wird sie bereit sein, Haus, Kratzbaum und Mensch/en mit ihresgleichen zu teilen.
Wer nur Platz für eine Katze hat, schaue sich bitte in den Tierheimen um. Dort sitzen auch Katzen, die absolut nicht mit ihresgleichen auskommen und einen Platz als Prinzessin oder Prinz ohne Konkurrenz zur menschlichen Bezugsperson brauchen und lieben. Diese Katzen sind zwar keine Kitten mehr, aber nicht unbedingt alt – und auf jeden Fall liebenswert.